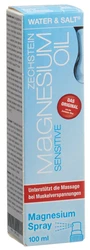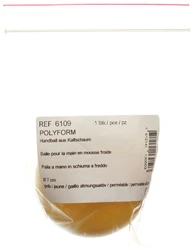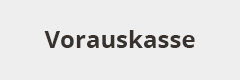Heute entscheiden Sie über Ihr zukünftiges Leben
Heute entscheiden Sie über Ihr zukünftiges Leben
Was ist Osteoporose?
Bei Osteoporose, einer chronischen Skeletterkrankung, verlieren die Knochen nach und nach an Substanz, Festigkeit und innerer Struktur. Dieses Ungleichgewicht entsteht, wenn der natürliche Prozess des Knochenumbaus aus dem Lot gerät und der Abbau den Aufbau überwiegt. Die Folgen sind eine Abnahme der Knochendichte und eine zunehmende Instabilität der Knochenstruktur. Dadurch steigt das Risiko, auch bei geringer Belastung Knochenbrüche zu erleiden.
Bereits alltägliche Bewegungen oder kleinere Stürze können bei Betroffenen Frakturen verursachen, vor allem an besonders belasteten Stellen wie der Wirbelsäule, dem Oberschenkelhals oder dem Handgelenk. Im Sprachgebrauch wird Osteoporose daher oft als „Knochenschwund“ bezeichnet, da die Knochen tatsächlich an Substanz verlieren.
Ein frühes Warnsignal kann die sogenannte Osteopenie sein, eine messbare Verringerung der Knochendichte. Sie gilt noch nicht als Osteoporose, zeigt aber ein erhöhtes Risiko für deren Entstehung an. Besonders im höheren Lebensalter beschleunigt sich der Knochenabbau, wobei hormonelle Veränderungen, etwa nach der Menopause, eine bedeutende Rolle spielen können.
Wie schützen Sie sich heute vor Osteoporose?
Welche Formen von Osteoporose gibt es?
Es gibt zwei Hauptformen der Osteoporose, die sich in ihrer Entstehung grundlegend unterscheiden: die primäre und die sekundäre Osteoporose.
Die primäre Osteoporose ist die weitaus häufigere Variante und tritt ohne das Vorliegen einer anderen Grunderkrankung auf. Sie entwickelt sich typischerweise im höheren Lebensalter, oft ab dem 70. Lebensjahr, oder im Zusammenhang mit hormonellen Veränderungen bei Frauen nach den Wechseljahren. Abhängig vom Lebensabschnitt lässt sich die primäre Form weiter unterteilen. Bei älteren Menschen spricht man von seniler Osteoporose (Typ II) und bei Frauen nach den Wechseljahren von postmenopausaler Osteoporose (Typ I). In seltenen Fällen kann sie auch bei jungen Menschen vorkommen, dann spricht man von juveniler Osteoporose.
Die sekundäre Osteoporose ist wesentlich seltener und entsteht infolge anderer gesundheitlicher Probleme oder als Nebenwirkung bestimmter Medikamente. Mögliche Auslöser sind Hormonstörungen wie eine Schilddrüsenüberfunktion, chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus, rheumatoide Arthritis oder Nierenschwäche sowie eine unzureichende Nährstoffversorgung durch einen langfristigen Vitamin-D- oder Kalziummangel oder durch Essstörungen wie Anorexie. Auch bestimmte Krebserkrankungen oder Therapien, die den Knochenstoffwechsel beeinträchtigen, können eine sekundäre Osteoporose begünstigen.
editorial.facts
- Das menschliche Skelett besteht aus mehr als 200 Knochen unterschiedlicher Form und Grösse.
- Bei gesunden älteren Menschen nimmt die Knochendichte pro Jahr um etwa 0.5 bis 1 % ab. Im Gegensatz dazu verläuft der Knochenschwund bei Osteoporose deutlich schneller: in schweren Fällen kann der jährliche Verlust bis zu 6 % betragen.
- Rund 95 % aller Osteoporosefälle entfallen auf die primäre Form, die ohne eine zugrunde liegende Erkrankung entsteht.
- Ein Viertel aller menschlichen Knochen befindet sich in den Händen, was die Komplexität und Beweglichkeit dieses Körperbereichs unterstreicht.
- Etwa 99 % des gesamten Kalziums im Körper sind in den Knochen eingelagert.
- Insgesamt macht das Skelett rund zehn Prozent des Körpergewichts aus.
Welche Symptome treten bei Osteoporose auf?
Osteoporose verläuft in den frühen Stadien häufig unbemerkt, da zunächst keine typischen Beschwerden auftreten. Erst im fortgeschrittenen Stadium zeigen sich Symptome, die meist auf bereits eingetretene Schäden am Skelettsystem zurückzuführen sind. Ein zentrales Merkmal ist die erhöhte Anfälligkeit für Knochenbrüche, die ohne nennenswerte Krafteinwirkung entstehen können.
Ein weiteres häufiges Anzeichen sind chronische Schmerzen, insbesondere im Bereich der Wirbelsäule. Diese entstehen oft durch Wirbelkörpereinbrüche, die zu einer Verformung und Instabilität des Rückens führen. Solche Veränderungen können sich durch eine sichtbare Abnahme der Körpergrösse oder eine veränderte Körperhaltung bemerkbar machen, beispielsweise durch einen Rundrücken oder ein ausgeprägtes Hohlkreuz.
Im Bereich der Wirbelsäule können sich auch „stille Frakturen“ entwickeln, die zunächst keine akuten Schmerzen verursachen. Im weiteren Verlauf kann es jedoch zu einem zunehmenden Verlust an Beweglichkeit, einem unsicheren Gang und einer eingeschränkten Selbstständigkeit im Alltag kommen. Auch ein vorgewölbter Unterbauch („Osteoporosebäuchlein“), eine Verkürzung des Rumpfes oder auffällige Hautfalten am Rücken, die als „Tannenbaumhaut“ bezeichnet werden, können auf eine fortgeschrittene Osteoporose hindeuten.
Ein Grössenverlust von mehr als vier Zentimetern innerhalb eines Jahres oder ein spürbar verringertes Abstandsniveau zwischen Rippen und Beckenkamm gelten ebenfalls als Hinweise. Oft tritt das erste spürbare Symptom jedoch erst mit dem Auftreten eines Knochenbruchs auf, häufig zu einem Zeitpunkt, an dem die Erkrankung bereits weit fortgeschritten ist.
Was sind die Ursachen für Osteoporose?
Osteoporose entsteht, wenn das Gleichgewicht zwischen Knochenaufbau und -abbau gestört ist, beispielsweise durch einen unzureichenden Aufbau in jungen Jahren oder einen übermässigen Abbau im späteren Leben. Dieses Missverhältnis kann viele verschiedene Ursachen haben, die sich grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen lassen: altersbedingte (primäre) und krankheitsbedingte (sekundäre) Einflüsse.
Bei der häufigeren primären Osteoporose spielt das Lebensalter eine zentrale Rolle. Ab dem vierten Lebensjahrzehnt beginnt der natürliche Rückgang der Knochensubstanz. Besonders bei Frauen nach den Wechseljahren beschleunigt sich dieser Prozess, da der Östrogenspiegel sinkt und dieses Hormon normalerweise den Knochenabbau bremst. Auch bei Männern kann eine Abnahme der Geschlechtshormone im Alter die Knochendichte negativ beeinflussen. Weitere Risikofaktoren sind eine genetische Veranlagung – insbesondere, wenn bereits nahe Angehörige betroffen waren – sowie ein zu geringes Körpergewicht, das oft mit einer unzureichenden Kalziumversorgung einhergeht.
Neben den natürlichen Alterungsvorgängen beeinflussen auch Lebensstilfaktoren das Osteoporoserisiko erheblich. Bewegungsmangel, insbesondere bei längerer Bettlägerigkeit oder eingeschränkter Mobilität, führt zum Abbau von Knochenmasse. Ebenso können eine unausgewogene Ernährung mit zu wenig Kalzium oder Vitamin D, Rauchen sowie übermässiger Konsum von Alkohol oder Koffein den Knochenstoffwechsel stören.
Die seltener auftretende sekundäre Osteoporose entsteht durch bestimmte Grunderkrankungen oder die Einnahme bestimmter Medikamente. Dazu zählen unter anderem hormonelle Störungen wie eine Schilddrüsenüberfunktion oder Diabetes, entzündliche Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis, chronische Darmerkrankungen oder Nierenleiden. Auch neurologische Erkrankungen mit eingeschränkter Muskelaktivität können die Knochensubstanz schwächen. Darüber hinaus können Medikamente wie Kortikosteroide oder bestimmte Antidepressiva die Osteoporose begünstigen.
Sind Osteoporose und Arthrose vergleichbar?
Osteoporose und Arthrose sind zwei weit verbreitete Erkrankungen des Bewegungsapparats. Zwar treten beide Erkrankungen häufiger im höheren Lebensalter auf, sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Entstehung, ihrem Verlauf und den betroffenen Strukturen. Bei Osteoporose wird die Stabilität der Knochen durch einen übermässigen Abbau der Knochensubstanz beeinträchtigt. Bei Arthrose handelt es sich dagegen um eine degenerative Veränderung der Gelenke, bei der insbesondere der Knorpel geschädigt wird.
Im Vordergrund steht der schleichende Verschleiss des Gelenkknorpels. Mit der Zeit nutzt sich der schützende Überzug ab, sodass die Knochen aufeinanderreiben. Dies führt zu Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und sichtbaren Veränderungen wie Gelenkverdickungen. Besonders häufig betroffen sind stark belastete Gelenke wie Knie, Hüfte oder Wirbelsäule. Im Gegensatz dazu bleibt Osteoporose oft lange unbemerkt, da sie zunächst keine Beschwerden verursacht. Erst bei fortgeschrittener Entkalkung der Knochen zeigen sich Symptome wie Rückenschmerzen oder Knochenbrüche nach geringfügigen Belastungen.
Therapie - Wie wird Osteoporose behandelt?
Bei der Therapie von Osteoporose werden medikamentöse und nicht-medikamentöse Massnahmen kombiniert, um Knochenbrüche zu verhindern und die Knochensubstanz zu erhalten. Medikamente wie Bisphosphonate oder Denosumab hemmen den Knochenabbau, während aufbauende Mittel wie Teriparatid oder Romosozumab bei schwerem Verlauf die Knochen gezielt stärken.
Zudem ist eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D wichtig, entweder über die Ernährung oder in Form von Präparaten. Körperliche Aktivität, insbesondere Krafttraining oder gezielte Physiotherapie, fördert die Knochengesundheit und verbessert die Koordination. Um Stürze zu vermeiden, sollten Betroffene ihre Wohnumgebung sicher gestalten und die Verwendung von Hilfsmitteln wie Hüftprotektoren in Erwägung ziehen.
Wie Sie Osteoporose vorbeugen können: hilfreiche Tipps
- Bewegen Sie sich so viel wie möglich. Je mehr Sie Ihr Knochengerüst beanspruchen, desto mehr wird der Aufbau Ihrer Knochen angeregt. Besonders gut für Knochenaufbau sind Wandern, Joggen und Ballsport, welche zusätzlich die Koordination und die Standfestigkeit trainieren, aber auch Kraftsport.
- Kalzium fördert die Stabilität der Knochen. Achten Sie auf ausreichend Kalziumquellen in Ihrer Ernährung. Top-Lieferanten sind Hartkäsesorten und grüne Gemüsesorten wie Grünkohl, Brokkoli, Feldsalat und Fenchel. Grünes Gemüse liefert daneben Vitamin K für die Knochenfestigkeit. Mineralwasser kann auch ein wichtiger Kalziumlieferant sein, doch beachten Sie, dass es maximal 50 Milligramm Natrium pro Liter enthalten sollte.
- Seien Sie zurückhaltend bei Kalziumräubern. Das sind Lebensmittel, welche die Aufnahme von Kalzium hemmen oder die Ausscheidung von Kalzium steigern. Dazu zählen kochsalz- und fettreiche Kost, Wurst, Fleisch, Schmelzkäse sowie Lebensmittel mit viel Oxalsäure wie Spinat, rote Beete, Rhabarber oder Schokolade.
- Legen Sie bei der Ernährung einen grossen Wert auf Vitamin D, das die Aufnahme von Kalzium und Phosphor unterstützt. Vitamin D steckt vor allem in fetten Seefischen wie Lachs, Hering oder Makrele, auch in Fleisch und Eiern.
- Für die Versorgung mit Vitamin D ist auch Sonnenlicht wichtig, da der Grossteil von Vitamin D von unserem Körper mit Hilfe des Sonnenlichts hergestellt wird. Verbringen Sie täglich 25 Minuten mit entblössten Armen oder Beinen sowie mit freiem Gesicht an der frischen Luft.
- Bei Bedarf können Sie zu Nahrungsergänzungen mit Vitamin D und Kalzium greifen, da es unserem Körper nicht immer leicht fällt, ausreichend Vitamin D zu produzieren und ausreichend Kalzium aufzunehmen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, ob es sich in Ihrem Fall lohnt.
- Verzichten Sie auf Genussmittel wie Alkohol und Nikotin. Diese fördern den Abbau der Knochendichte, verhindern die Kalziumaufnahme und schädigen Ihrer Gesundheit auf vielfältige Art.
- Lassen Sie regelmässig eine Knochendichtemessung durchführen, um Veränderungen der Wirbelkörper, ein erhöhtes Frakturrisiko, eine übermässige Aktivität der Osteoklasten oder einen Mangel an Hormonen wie Östrogen frühzeitig zu erkennen und eine gezielte Diagnose zu ermöglichen.
- Bei einem schon vorhandenen Knochenschwund kann Ihr Arzt spezielle Medikamente verschreiben, welche den Knochenabbau hemmen.
Wer seine Knochen stärkt, investiert in seine Mobilität und Lebensqualität im Alter. Durch die richtige Vorsorge und Behandlung lässt sich das Risiko für Brüche deutlich senken.