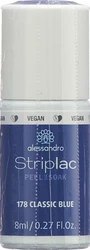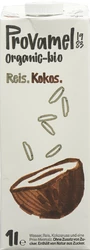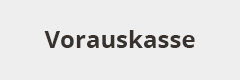Wenn der Himmel unsere Gefühle lenkt
Wenn der Himmel unsere Gefühle lenkt
Was ist Wetterfühligkeit?
Als Wetterfühligkeit, in der Medizin auch Meteoropathie genannt, wird eine besondere Sensibilität gegenüber Veränderungen der Wetterlage bezeichnet. Damit sind vor allem plötzliche Schwankungen von Temperatur, Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit gemeint, wie sie beispielsweise bei einem herannahenden Sturm, bei Hitzewellen oder nach einem Regenschauer mit hoher Luftfeuchtigkeit auftreten. Solche Wetterumschwünge scheinen das körperliche und seelische Gleichgewicht vieler Menschen zu beeinflussen.
Da Wetterfühligkeit individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, lassen sich die Reaktionen oft nicht klar messen oder objektiv belegen. Dennoch zeigen Befragungen, dass sich viele Menschen bei bestimmten Wetterlagen beeinträchtigt fühlen, wobei Frauen häufiger von solchen Wahrnehmungen berichten. In der Medizin wird Wetterfühligkeit daher als Befindlichkeitsstörung eingeordnet, das heisst als eine Beeinträchtigung des allgemeinen Wohlbefindens, ohne dass eine klar definierte Erkrankung vorliegt.
editorial.facts
- Als Wetterfühligkeit wird eine Überempfindlichkeit des vegetativen Nervensystems gegenüber Wetteränderungen bezeichnet. Sie beeinflusst das Wohlbefinden, ohne dass eine Krankheit vorliegt. Wetterempfindlichkeit kann hingegen vorhandene Beschwerden oder Krankheiten durch Wetterwechsel verschlechtern.
- Das Wetter ist ein wichtiger Umweltfaktor, auf den der menschliche Körper immer reagiert.
- Organfunktionen arbeiten am besten bei einer konstanten Körperkerntemperatur von etwa 37 °C. Wetter- und Temperaturänderungen lösen Anpassungen im vegetativen Nervensystem und Hormonhaushalt aus, die bei wetterfühligen Menschen deutlich spürbar sind.
Gibt es Wetterfühligkeit wirklich?
Wetterfühligkeit ist kein Hirngespinst, sondern ein reales Phänomen, das in der medizinischen Forschung mittlerweile ernst genommen wird. Zwar gibt es innerhalb der Wissenschaft unterschiedliche Auffassungen über das Ausmass und die genauen Mechanismen, doch zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Wetterveränderungen durchaus Körperreaktionen auslösen können – insbesondere bei sensiblen Personen. So gibt es beispielsweise Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Luftdruckschwankungen und Migräne sowie Berichte über verstärkte Schmerzen bei Arthrose- oder Rheumapatienten bei feucht-kaltem Wetter.
Gleichzeitig bleibt zu beachten: die wissenschaftliche Beweislage ist nicht einheitlich. Einige Untersuchungen bestätigen die Wirkung des Wetters auf bestimmte Symptome, während andere keine eindeutigen Zusammenhänge feststellen konnten. Das liegt unter anderem daran, dass sich bei einem Wetterwechsel meist mehrere Faktoren gleichzeitig ändern, zum Beispiel Temperatur, Luftdruck und Feuchtigkeit, was eine isolierte Analyse erschwert.
Welche Symptome haben Menschen bei Wetterfühligkeit?
Menschen, die unter Wetterfühligkeit leiden, können eine Vielzahl unterschiedlicher körperlicher und psychischer Beschwerden erleben, die je nach Wetterlage und individueller Veranlagung variieren. Häufige erste Anzeichen sind anhaltende oder plötzlich auftretende Kopfschmerzen sowie Migräneanfälle, insbesondere bei raschen Luftdruckveränderungen oder Föhnwetterlagen. Ebenso verbreitet sind Erschöpfungsgefühle, ein ausgeprägtes Schlafbedürfnis und allgemeine Kraftlosigkeit, die mit einem Gefühl der Benommenheit einhergehen können.
Viele Betroffene berichten ausserdem von innerer Unruhe, gesteigerter Reizbarkeit oder gedrückter Stimmung. Auch die geistige Leistungsfähigkeit ist oft beeinträchtigt: Konzentrationsprobleme und Gedächtnisstörungen sind in Zeiten mit vielen Wetterumschwüngen keine Seltenheit. In manchen Fällen beeinträchtigt das Wetter sogar den Schlafrhythmus, was zur allgemeinen Erschöpfung beitragen kann.
Neben diesen neurovegetativen und psychischen Symptomen können sich wetterbedingte Beschwerden auch auf den Bewegungsapparat auswirken. Insbesondere bei plötzlichen Temperaturwechseln treten Muskelschmerzen, Gelenkprobleme oder sogar Schmerzen an alten Verletzungsstellen, beispielsweise an Narben, auf. Darüber hinaus berichten manche Menschen von Atembeschwerden oder Engegefühlen in der Brust, die sich wetterabhängig verschärfen können.
Bei manchen Witterungslagen reagieren auch das Herz-Kreislauf-System und die Blutgefässe empfindlich. Kreislaufschwäche, Schwankungen des Blutdrucks oder sogar Schwellungen an Händen und Füssen, die beispielsweise durch Hitze verursacht werden, gehören ebenfalls zu den möglichen Symptomen. In Einzelfällen wurden auch Thrombosen als Reaktion auf starke Witterungsveränderungen beobachtet.
Inwieweit beeinflusst die Wetterfühligkeit Ihren Alltag?
Was sind die Ursachen von Wetterfühligkeit?
Die genauen Ursachen sind wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt, es gibt jedoch mehrere plausible Theorien. Dabei spielt die Fähigkeit des Körpers, flexibel auf klimatische Veränderungen zu reagieren, eine zentrale Rolle. Tritt beispielsweise eine Temperaturschwankung oder eine Veränderung des Luftdrucks auf, wird das vegetative Nervensystem aktiviert, um die Körperfunktionen entsprechend anzupassen, insbesondere die Regulierung der Körperkerntemperatur. Während diese Anpassungsprozesse bei gesunden Menschen oft unbemerkt verlaufen, geraten sie bei Personen mit eingeschränkter Regulationsfähigkeit leichter aus dem Gleichgewicht.
Zudem scheint die moderne Lebensweise eine Rolle zu spielen. Wer sich vorwiegend in geschlossenen, klimatisierten Räumen aufhält, entzieht seinem Körper die Möglichkeit, sich kontinuierlich an natürliche Temperaturschwankungen zu gewöhnen. Auch ein geschwächtes Immunsystem oder eine unausgewogene Ernährung können die körperliche Widerstandskraft gegenüber äusseren Einflussfaktoren beeinträchtigen.
Ein weiterer möglicher Faktor ist das Verhalten der sogenannten Barorezeptoren. Das sind spezielle Sinneszellen, die auf Änderungen des Luftdrucks reagieren. Werden diese gestört, kann das Gehirn fehlerhafte Signale erhalten, was sich in Form von Unwohlsein äussern kann. Zusätzlich werden elektromagnetische Felder in der Atmosphäre, sogenannte Sferics, als potenzieller Auslöser diskutiert, obwohl ihre Wirkung noch nicht abschliessend geklärt ist.
Nicht zuletzt scheinen auch regionale und klimatische Besonderheiten einen Einfluss auszuüben. So berichten Menschen in Gebieten mit häufigen und abrupten Wetterwechseln wie dem Alpenraum häufiger von wetterbedingten Beschwerden als Menschen in Regionen mit konstanterem Klima.
Welchen Einfluss hat das Wetter auf den Blutdruck?
Das Wetter hat vor allem durch Temperaturschwankungen Einfluss auf den Blutdruck. Kälte führt zu einer Verengung der Blutgefässe, wodurch der Blutdruck ansteigt und das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Thrombosen steigt. Hohe Temperaturen bewirken hingegen eine Erweiterung der Gefässe und senken somit den Blutdruck. Dies kann bei Menschen mit niedrigem Blutdruck oder bei Einnahme blutdrucksenkender Medikamente zu Schwindel, Müdigkeit und Kreislaufproblemen führen.
Plötzliche Temperaturwechsel von mehr als fünf Grad oder starkeLuftdruckschwankungen belasten das Herz-Kreislauf-System zusätzlich und erhöhen bei Menschen mit Bluthochdruck das Risiko für Herzrhythmusstörungen und Gefässverkrampfungen. Besonders bei längeren Hitzeperioden kann der Blutdruck dauerhaft absinken, sodass eine Anpassung der Medikation notwendig werden kann.
Menschen mit Bluthochdruck sollten bei Reisen in wärmere Klimazonen ihre Medikation und Blutdruckwerte engmaschig überwachen, die Einnahmezeiten an Zeitverschiebungen anpassen und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Personen, die kürzlich einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben, sowie Personen mit instabiler Medikation, sollten solche Reisen vermeiden, da Temperatur- und Ortswechsel zusätzlichen Stress für das Herz bedeuten.
Was man gegen Wetterfühligkeit tun kann: wirksame Tipps
- Nutzen Sie das Zwiebelprinzip bei Ihrer Kleidung, um flexibel auf Temperaturwechsel reagieren zu können. Tragen Sie mehrere dünne, atmungsaktive Kleidungsstücke, die Sie je nach Bedarf an- oder ausziehen können. Das ist besonders praktisch bei unvorhersehbarem Frühlings- oder Herbstwetter.
- Beginnen Sie mit täglichen Wechselduschen, um Ihre Gefässe zu trainieren und Ihre Thermoregulation zu stärken. Duschen Sie morgens zunächst mit warmem Wasser und beenden Sie die Dusche mit kaltem Wasser. Das fördert die Anpassungsfähigkeit Ihres Körpers an schwankende Temperaturen.
- Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte durch eine vitaminreiche Ernährung. Achten Sie auf frisches Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte. Besonders wichtig sind die Vitamine C, D und B-Komplex sowie die Mineralstoffe Zink und Magnesium.
- Gehen Sie bei jedem Wetter an die frische Luft, auch wenn es regnet oder windig ist. Schon 20 Minuten Bewegung im Park, beim Einkaufen oder auf dem Heimweg helfen Ihrem Körper, sich besser an wechselnde Wetterbedingungen zu gewöhnen.
- Sorgen Sie ausserdem für einen konstanten Schlafrhythmus, indem Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufstehen – auch am Wochenende. Ein geregelter Schlaf unterstützt das Immunsystem und reduziert wetterbedingte Erschöpfung.
- Setzen Sie ausserdem auf magnesiumreiche Lebensmittel wie Haferflocken, Spinat, Mandeln oder Sonnenblumenkerne. Magnesium wirkt entspannend auf die Muskulatur und hilft bei wetterbedingten Kopfschmerzen oder Unruhe.
- Verzichten Sie in empfindlichen Phasen auf Genussmittel wie Kaffee, Alkohol oder Nikotin. Diese Stoffe können die Symptome der Wetterfühligkeit wie Kopfschmerzen oder Nervosität verstärken.
- Bei akuten Kopfschmerzen können Sie kalte oder warme Kompressen auf Stirn, Schläfen oder Nacken anwenden. Je nach Empfinden kann Wärme entspannen oder Kälte den Schmerzreiz lindern. Finden Sie heraus, was Ihnen guttut.
- Sie können auch Pfefferminzöl verwenden, indem Sie ein paar Tropfen auf die Schläfen oder die schmerzenden Gelenke reiben. Es kühlt, wirkt schmerzlindernd und kann besonders bei Spannungskopfschmerzen hilfreich sein.
- Vermeiden Sie es, bei wetterbedingten Beschwerden wie Schwindel oder starker Müdigkeit Auto zu fahren. Ihre Reaktionsfähigkeit kann eingeschränkt sein und das Unfallrisiko ist erhöht. Greifen Sie in solchen Fällen lieber auf öffentliche Verkehrsmittel zurück.
- Bauen Sie ausserdem moderate Bewegung wie Yoga oder Radfahren in Ihren Alltag ein. Schon dreimal pro Woche reicht aus, um Ihre Durchblutung zu fördern und Wetterumschwünge gelassener zu erleben.
- Vermeiden Sie hektische Tagesabläufe, besonders bei instabilem Wetter. Planen Sie ausreichend Pausen ein und integrieren Sie Entspannungstechniken wie Atemübungen oder Meditation, um stressbedingte Beschwerden zu verringern.
- Laden Sie sich eine App für meteorologische Warnungen vom Wetterdienst herunter. So können Sie bei Föhn, Gewitter oder Wetterumschwung rechtzeitig gegen Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen und ähnliche Folgen für Ihre Gesundheit vorgehen.
- Lassen Sie sich bei anhaltenden Beschwerden ärztlich beraten. Wenn Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen oder starke Müdigkeit länger als zwei Tage anhalten, sollten Sie die Ursache medizinisch abklären lassen, um auch andere Erkrankungen auszuschliessen.
Wetterfühligkeit zeigt, wie eng unser Befinden mit den Veränderungen der Natur verbunden ist. Wer seine eigenen Reaktionen kennt, kann gezielt gegensteuern und somit den Alltag besser meistern.