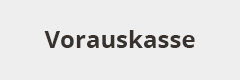So ein Drama jeden Monat
So ein Drama jeden Monat
Was ist das prämenstruelle Syndrom (PMS)?
Das prämenstruelle Syndrom (PMS) bezeichnet ein regelmässig wiederkehrendes Beschwerdebild, das in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, bis kurz vor dem Beginn der Menstruation auftritt. Es umfasst sowohl körperliche als auch psychische Symptome, die je nach Person unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Während manche Betroffene nur leicht beeinträchtigt sind, empfinden andere die Beschwerden als deutlich belastend.
Charakteristisch ist der enge Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus: die Symptome treten nur in einer bestimmten Phase auf und klingen mit Beginn der Regelblutung meist vollständig ab. Dieser zeitliche Ablauf unterscheidet PMS von anderen gesundheitlichen Problemen.
Da die hormonelle Zyklussteuerung individuell verläuft, reagieren Betroffene unterschiedlich sensibel auf diese biologischen Prozesse. Auch die Zykluslänge kann von Person zu Person variieren, was zusätzlich erklärt, warum PMS nicht bei allen gleich verläuft.
Wie erkennt man PMS?
PMS macht sich durch eine Vielzahl von Beschwerden bemerkbar, die sowohl körperlicher als auch psychischer Natur sein können. Auffällig sind beispielsweise Spannungsgefühle, Schmerzen oder Schwellungen in der Brust. Viele Betroffene berichten zudem von Unterleibskrämpfen, Rückenschmerzen oder migräneartigen Kopfschmerzen, die in die Schultern, den Nacken oder die Schläfen ausstrahlen können. Häufig treten zudem Gelenk- und Muskelschmerzen, Hitzewallungen, Übelkeit sowie Schwindel, Herzklopfen und Benommenheit auf. In manchen Fällen kommt es sogar zu Kreislaufschwäche oder kurzzeitiger Ohnmacht.
Typisch sind zudem Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl, Verstopfung oder Durchfall. Auch Hautprobleme wie Akne, fettige oder gereizte Haut sowie ein Kribbeln in Händen oder Füssen können auf PMS hinweisen. Viele Frauen nehmen vor ihrer Periode eine vorübergehende Gewichtszunahme durch Wassereinlagerungen wahr, die sich vor allem an Knöcheln, Händen oder im Bauchraum bemerkbar macht. Heisshungerattacken, Appetitverlust oder auffällige Veränderungen im Essverhalten sind ebenfalls nicht ungewöhnlich. Auch Schlafprobleme wie Ein- oder Durchschlafstörungen können auftreten.
Auf psychischer Ebene zeigen sich PMS-Beschwerden oft in Form von Stimmungsschwankungen, die von Gereiztheit und innerer Unruhe bis hin zu depressiven Phasen reichen können. Einige Betroffene erleben im Tagesverlauf wechselnde Zustände von Hyperaktivität und Erschöpfung. Angstgefühle, Nervosität oder das Gefühl, ständig unter Druck zu stehen, sind ebenfalls häufig. Ebenso können Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Konzentrationsprobleme oder ein Gefühl der Überforderung auftreten. Einige Frauen berichten auch von plötzlicher Wut, Weinkrämpfen oder dem Eindruck, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren.
editorial.facts
- Etwa jede dritte Frau im gebärfähigen Alter leidet unter stark ausgeprägten prämenstruellen Beschwerden.
- Leichte körperliche und emotionale Veränderungen vor der Menstruation sind dagegen bei rund 80 % aller menstruierenden Frauen regelmässig zu beobachten.
- PMDS ist eine schwere Form des PMS, die sich durch starke psychische Symptome auszeichnet und 3 bis 8 % der Frauen betrifft.
- Beim PMS wurden über 150 verschiedene körperliche und psychische Symptome beschrieben.
- Die PMDS ist seit 2022 von der WHO als eigenständige Erkrankung anerkannt.
Was sind die Ursachen von PMS?
Die genauen Auslöser des prämenstruellen Syndroms (PMS) sind bislang nicht vollständig erforscht. Es wird jedoch angenommen, dass mehrere Faktoren zusammenwirken. Im Mittelpunkt stehen dabei hormonelle Veränderungen im Laufe des weiblichen Zyklus, insbesondere Schwankungen der Östrogen- und Progesteronspiegel nach dem Eisprung. Diese natürlichen Schwankungen können bei manchen Frauen empfindlichere Reaktionen im Nervensystem auslösen, da bestimmte Stoffwechselprodukte der Hormone vermutlich Einfluss auf die Körpertemperatur, die Schlafqualität oder die Stimmung nehmen.
Auch neurobiologische Prozesse spielen eine Rolle: Studien deuten darauf hin, dass hormonelle Schwankungen das Gleichgewicht von Neurotransmittern wie Serotonin stören könnten. Dieser Botenstoff ist entscheidend für das emotionale Wohlbefinden und den Schlaf. Ein rapider Serotoninabfall kann daher mit Symptomen wie Reizbarkeit oder gedrückter Stimmung einhergehen. Neben Serotonin werden auch andere Botenstoffe wie Dopamin oder Melatonin als mögliche Mitverursacher diskutiert.
Darüber hinaus gibt es Hinweise auf eine genetische Komponente, denn PMS tritt häufig gehäuft innerhalb von Familien auf. Genetische Faktoren könnten die Empfindlichkeit gegenüber Hormonschwankungen verstärken oder die Reizverarbeitung im Gehirn beeinflussen. Neuere Untersuchungen zeigen zudem, dass bei betroffenen Frauen bestimmte Gene aktiver sind, welche die Reaktion auf Sexualhormone modulieren.
Weitere Einflussfaktoren betreffen den Lebensstil und die Umwelt. So können beispielsweise chronischer Stress, unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel, Schlafstörungen, Rauchen oder Alkoholkonsum die Beschwerden verschlimmern. Auch ein Mangel an bestimmten Nährstoffen, etwa Eisen oder B-Vitaminen, wird in diesem Zusammenhang diskutiert. Zudem kann die Funktion der Schilddrüse eine Rolle spielen, da ihre Hormone den Energiehaushalt und das seelische Gleichgewicht beeinflussen.
Schliesslich wird auch der psychosoziale Aspekt berücksichtigt. Negative Einstellungen gegenüber dem eigenen Zyklus oder gesellschaftlich vermittelte Bilder von Weiblichkeit können dazu führen, dass die körperlichen Veränderungen in der zweiten Zyklushälfte als belastender empfunden werden.
Welche Hilfsmittel nutzen Sie normalerweise gegen PMS?
Was ist der Unterschied zwischen PMS und PMDS?
Sowohl das prämenstruelle Syndrom (PMS) als auch die prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS) sind zyklusabhängige Beschwerden, die in der zweiten Hälfte des Menstruationszyklus auftreten. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Ausprägung und ihren Auswirkungen. Während PMS mit einer Vielzahl körperlicher und psychischer Symptome einhergeht, ist PMDS eine besonders schwere Form davon, bei der vor allem die psychische Belastung im Vordergrund steht.
Ein wesentlicher Unterschied besteht im Schweregrad der Symptome. PMS äussert sich häufig durch leichte bis mittelschwere Beschwerden. Bei PMDS dominieren hingegen intensive psychische Symptome wie ausgeprägte Reizbarkeit, plötzliche Wutausbrüche, Angstzustände, Hoffnungslosigkeit oder depressive Verstimmungen, die deutlich über das Mass normaler Stimmungsschwankungen hinausgehen. Diese Beschwerden können so stark sein, dass sie das soziale und berufliche Leben erheblich beeinträchtigen.
Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Diagnose: für PMS genügt das Auftreten einzelner Symptome vor der Regelblutung. Bei PMDS müssen dagegen laut den Kriterien des DSM-V mindestens fünf Symptome regelmässig im Zyklusverlauf auftreten, darunter mindestens ein schwerwiegendes affektives Symptom. Charakteristisch ist, dass diese Beschwerden wenige Tage vor der Menstruation beginnen und mit dem Einsetzen der Blutung wieder abklingen.
Bei PMDS spielt zudem die emotionale Komponente eine zentrale Rolle: Betroffene fühlen sich oft überwältigt und erschöpft, ziehen sich zurück oder erleben eine drastische Persönlichkeitsveränderung. Diese seelischen Beschwerden gehen meist mit körperlichen Symptomen einher, sind aber intensiver und nachhaltiger als bei PMS.
Kann ich während der PMS-Phase schwanger werden?
Auch wenn es zunächst unwahrscheinlich klingt, ist eine Schwangerschaft während der PMS-Phase nicht völlig ausgeschlossen – vor allem dann nicht, wenn der Zyklus unregelmässig oder verkürzt ist. Die prämenstruelle Phase markiert normalerweise das Ende des Zyklus, also die Zeit nach der Freisetzung der Eizelle und vor der nächsten Menstruation. In einem typischen Zyklus ist diese Phase nicht fruchtbar, da die Befruchtungsfähigkeit der Eizelle bereits vorüber ist. Dennoch gibt es Ausnahmen, die diesen Zeitraum potenziell riskant machen können.
Ein Grund dafür ist die natürliche Variabilität des weiblichen Zyklus: der Eisprung kann sich durch äussere Einflüsse wie Stress, Krankheit oder Hormonschwankungen verschieben – sowohl nach hinten als auch nach vorne. Das kann dazu führen, dass man sich irrtümlicherweise in einer „sicheren” Phase wähnt, obwohl der fruchtbare Zeitraum gerade erst begonnen hat oder unmittelbar bevorsteht.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Lebensdauer der Spermien. Diese können im weiblichen Körper bis zu fünf Tagen überleben. Wenn eine Frau also kurz vor einem verspäteten Eizellfreisetzung – beispielsweise gegen Ende der PMS-Phase – Sex hat, können zum Zeitpunkt der Eizellfreisetzung noch befruchtungsfähige Spermien im Körper vorhanden sein. So kann eine Schwangerschaft auch dann entstehen, wenn der Geschlechtsverkehr einige Tage vor dem tatsächlichen Zeitpunkt der Eizellfreisetzung stattgefunden hat.
Frauen mit kurzen oder wechselhaften Zyklen sollten deshalb besonders darauf achten. PMS-Symptome sind kein verlässlicher Hinweis auf Unfruchtbarkeit. Nur eine sichere Verhütungsmethode bietet Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft – auch in Zyklusphasen, die scheinbar ausserhalb des fruchtbaren Fensters liegen.
Was man gegen PMS-Symptome tun kann: hilfreiche Tipps
- Achten Sie auf regelmässigen, erholsamen Schlaf von möglichst 7 bis 9 Stunden pro Nacht. Gehen Sie möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie immer zur gleichen Zeit auf, auch am Wochenende. Vermeiden Sie vor dem Einschlafen Bildschirme, Koffein und schwere Mahlzeiten.
- Reduzieren Sie aktiv Stress in der zweiten Zyklushälfte. Planen Sie bewusst entspannende Aktivitäten wie Spaziergänge, ruhige Abende oder Atemübungen ein und vermeiden Sie unnötige Belastungen im Alltag.
- Integrieren Sie leichte Bewegung in Ihren Tagesablauf. Schon 20 Minuten Yoga, Schwimmen oder ein Spaziergang an der frischen Luft helfen, Krämpfe zu lösen und die Stimmung zu heben. Bewegung im Freien verstärkt die Wirkung durch Licht und Sauerstoffzufuhr.
- Achten Sie ausserdem auf eine magnesiumreiche Ernährung, um Krämpfen vorzubeugen. Essen Sie täglich eine Portion magnesiumreicher Lebensmittel wie Kürbiskerne, Haferflocken oder grünes Blattgemüse – beispielsweise als Salat, Topping oder im Müsli.
- Essen Sie bei Verdauungsbeschwerden täglich ballaststoffreiche Nahrungsmittel. Integrieren Sie beispielsweise eine Portion Linsen, Vollkornbrot oder Obst mit Schale in Ihre Mahlzeiten. Trinken Sie ausreichend, um die Wirkung der Ballaststoffe zu unterstützen.
- Trinken Sie bei Kopfschmerzen oder PMS-Migräne ein Glas Wasser und kühlen Sie Ihre Stirn. Ein kalter, feuchter Waschlappen oder ein Kühlpad auf der Stirn kann die Schmerzen lindern. Kombinieren Sie dies mit Ruhe in einem abgedunkelten Raum.
- Verwenden Sie gezielt Kräutertees gegen Verdauungsbeschwerden. Trinken Sie nach dem Essen eine Tasse Fenchel-Anis-Kümmel-Tee oder Kamillentee, um Blähungen, Übelkeit oder Bauchdruck sanft zu lindern.
- Bei Bauchschmerzen können Sie eine Wärmflasche oder ein Heizkissen gezielt im unteren Rücken oder Unterbauch verwenden. Setzen Sie die Wärmequelle mindestens 15 Minuten lang ein, idealerweise während einer Ruhepause. Auch warme Kleidung im Lendenbereich kann wohltuend wirken.
- Bei Übelkeit kann Ingwer in Form von Tee oder Kapseln helfen. Trinken Sie beispielsweise frisch aufgebrühten Ingwertee mit Zitrone oder nehmen Sie morgens vor dem Frühstück standardisierte Ingwerkapseln ein.
- Bei Kopfschmerzen tragen Sie Pfefferminzöl auf die Schläfen auf. Massieren Sie ein bis zwei Tropfen mit kreisenden Bewegungen ein und achten Sie dabei darauf, dass das Öl nicht in die Augen gelangt.
- Um innere Unruhe zu mindern, trinken Sie Lavendeltee oder nutzen Sie Lavendelöl. Ein warmes Lavendelbad oder ein Tropfen Lavendelöl auf dem Kopfkissen kann entspannend wirken und beim Einschlafen helfen.
- Verwenden Sie Mönchspfeffer zur Behandlung von prämenstruellen Beschwerden (premenstrual), etwa Brustspannen oder Depression. Er stabilisiert den Spiegel des Hormons Progesteron, lindert das Leiden, auch vor den Wechseljahren, und kann nicht-hormonelle Verhütungsmittel sinnvoll ergänzen.
- Beobachten Sie Ihre Symptome mithilfe einer App. Dokumentieren Sie täglich Ihre Stimmung, Ihre Schmerzen, Ihren Schlaf, Ihre Ernährung und Ihre Medikamente, um Zusammenhänge und individuelle Auslöser zu erkennen.
- Vermeiden Sie bei starker Blutung Schmerzmittel mit ASS. Setzen Sie stattdessen auf Ibuprofen oder andere geeignete Präparate, aber nur nach Rücksprache mit einem Arzt, um Nebenwirkungen zu vermeiden.
- Bei starken psychischen Beschwerden kann die ärztlich begleitete Einnahme von SSRIs in der zweiten Hälfte des Menstruationszyklus hilfreich sein. Besprechen Sie diese Option mit einer Fachperson. Eine gezielte, zeitlich begrenzte Einnahme kann die Nebenwirkungen reduzieren und dennoch wirksam sein.
PMS ist kein Schicksal, dem man sich fügen muss. Durch Selbstbeobachtung und geeignete Massnahmen lässt sich diese Phase oft deutlich erleichtern.