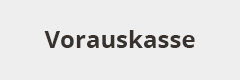Wenn es Ihnen einfach richtig mies geht
Wenn es Ihnen einfach richtig mies geht
Was ist eine Grippe?
Die Grippe (medizinisch: Influenza) ist eine akute Virusinfektion, die typischerweise rasch einsetzt und sich weltweit verbreitet. Sie zählt zu den ernstzunehmenden Erkrankungen der Atemwege und kann den gesamten Körper belasten. Charakteristisch für sie ist das abrupte Auftreten mit einem plötzlich einsetzenden Krankheitsgefühl. Da sie vor allem in den Wintermonaten gehäuft auftritt, wird sie auch als saisonale Grippe bezeichnet.
Verursacht wird sie durch Influenza-Viren, die sich in verschiedene Typen unterteilen. Insbesondere die Typen A und B spielen beim Menschen eine zentrale Rolle. Typ A ist häufig für grossflächige Grippewellen verantwortlich und verändert sich ständig genetisch. Auch Typ B kann schwerwiegende Verläufe verursachen. Typ C hingegen führt meist nur zu leichten Beschwerden und tritt eher vereinzelt auf.
Das Virus verändert sich fortlaufend, wodurch regelmässig neue Varianten entstehen. Diese hohe Wandlungsfähigkeit stellt eine besondere Herausforderung dar, da das Immunsystem nicht immer auf bereits gebildete Antikörper zurückgreifen kann. Selbst wer in der Vergangenheit eine Grippe durchgemacht oder eine Impfung erhalten hat, ist nicht automatisch gegen zukünftige Virusvarianten geschützt, da sich die Erreger genetisch unterscheiden können.
editorial.facts
- Nur etwa ein Drittel der Infizierten entwickelt die typischen Grippesymptome wie hohes Fieber, starke Gliederschmerzen und ausgeprägte Erschöpfung. Ein weiteres Drittel zeigt lediglich milde Beschwerden, die mit einer einfachen Erkältung vergleichbar sind. Der restliche Teil der Infizierten bemerkt die Erkrankung überhaupt nicht.
- Auch nach einer durchgemachten Grippe ist man nicht dauerhaft immun, da zahlreiche unterschiedliche Influenzaviren zirkulieren, gegen die keine lebenslange Abwehr besteht.
- Influenzaviren sind sehr widerstandsfähig. Sie können sich bei Kälte auf Oberflächen wie Kunststoff oder Metall mehrere Stunden bis zu einigen Tagen halten und infektiös bleiben.
- Da Antibiotika nur gegen Bakterien wirken, sind sie bei Virusinfektionen wie der Influenza oder einer Erkältung wirkungslos und daher nicht zur Behandlung geeignet.
Wie wird die Grippe übertragen?
Die Grippe wird vor allem durch direkten Kontakt zwischen Menschen übertragen. Besonders häufig geschieht dies über feinste Tröpfchen, die beim Husten, Niesen oder sogar beim Sprechen freigesetzt werden. Diese winzigen Partikel enthalten Viren und gelangen in die Luft, wo sie von anderen Personen in der unmittelbaren Umgebung eingeatmet werden können.
Neben der Übertragung über die Atemluft ist auch der Kontakt mit verunreinigten Händen ein bedeutender Infektionsweg. Wenn virushaltige Sekrete – etwa durch Naseputzen oder Berühren des Gesichts – an die Hände gelangen, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Organismus eindringen, wenn man sich unbewusst ins Gesicht fasst.
Darüber hinaus spielen kontaminierte Oberflächen im Alltag eine wichtige Rolle: Türklinken, Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder andere häufig berührte Gegenstände können Viruspartikel tragen. Wird eine solche Fläche angefasst und anschliessend das Gesicht berührt, kann es auch auf diesem Weg zur Infektion kommen.
Die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Auftreten erster Symptome beträgt in der Regel ein bis vier Tage. Bereits bevor Krankheitszeichen erkennbar sind, kann eine infizierte Person andere anstecken.
Wie schützen Sie sich vor Grippe?
Welche Symptome zeigen sich bei einer Grippe?
Eine Influenza beginnt meist abrupt und geht mit einer rasch zunehmenden körperlichen Erschöpfung einher. Betroffene verspüren häufig bereits kurz nach der Ansteckung ein deutliches Krankheitsgefühl, das von hohem Fieber, starkem Frösteln sowie intensiven Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen begleitet wird. Typisch sind zudem ein trockener, quälender Husten ohne Schleimbildung, Halsschmerzen und ein brennendes Gefühl im Rachen. Auch Schweissausbrüche, Appetitlosigkeit und eine ausgeprägte Licht- oder Geräuschempfindlichkeit sind möglich.
Ergänzend kann es zu Schnupfen mit verstopfter oder laufender Nase kommen, wobei dieser meist weniger im Vordergrund steht. Bei Kindern können zusätzlich Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auftreten. Gelegentlich treten auch Ohrenschmerzen, Ausschläge oder Pseudokrupp auf. Bei älteren Menschen kann sich eine Grippe durch Orientierungslosigkeit oder Verwirrtheit äussern, selbst wenn das Fieber fehlt.
Die Ausprägung der Symptome variiert von Mensch zu Mensch: manche entwickeln ein vollständiges Beschwerdebild mit Fieber, während andere nur abgeschwächte oder gar keine Anzeichen einer Infektion zeigen.
Wie kann eine Impfung gegen Grippe schützen?
Eine Grippeimpfung verringert das Risiko einer schweren Influenzaerkrankung deutlich. Zwar kann sie eine Infektion nicht in jedem Fall verhindern, doch geimpfte Personen haben in der Regel einen milderen Krankheitsverlauf und sind besser vor Komplikationen wie Lungenentzündung, Mittelohrentzündung oder Herzmuskelentzündung geschützt. Auch das Risiko für schwerwiegende Folgeereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall wird durch die Impfung reduziert.
Wie gut der Impfstoff wirkt, hängt davon ab, wie gut er mit den tatsächlich zirkulierenden Viren übereinstimmt. Bei jungen Erwachsenen kann die Schutzwirkung bis zu 80 % betragen, bei Kindern und Jugendlichen liegt sie zwischen 59 % und 75 %. Ältere Menschen sprechen immunologisch oft schwächer auf die Impfung an, profitieren aber dennoch, da ihr Erkrankungsrisiko um bis zu 63 % gesenkt werden kann. Für sie steht zusätzlich ein Impfstoff mit Wirkverstärker zur Verfügung, der die Abwehrreaktion verbessern kann.
Da sich Grippeviren laufend verändern, muss der Impfstoff jährlich neu angepasst werden. Die Prognose, welche Erreger in der kommenden Saison vorherrschen werden, basiert auf weltweiten Beobachtungen. Trotz der Herausforderungen bei der Produktion gelingt es so, jedes Jahr zahlreiche Erkrankungen und schwere Verläufe zu verhindern.
Grippe oder grippaler Infekt?
Die Begriffe „Grippe“ und „grippaler Infekt“ werden im Alltag häufig synonym verwendet, obwohl sie unterschiedliche Krankheitsbilder beschreiben. Ein grippaler Infekt, umgangssprachlich auch Erkältung genannt, entwickelt sich in der Regel schrittweise. Er beginnt meist mit leichtem Halskratzen oder einer verstopften Nase und verläuft meist mild. Verantwortlich dafür sind zahlreiche verschiedene Virustypen, die meist nur zu moderaten Beschwerden führen.
Demgegenüber steht die Influenza, also die „echte Grippe“, die durch spezifische Influenza-Viren ausgelöst wird. Diese Erkrankung zeichnet sich durch einen abrupten Beginn mit sehr stark ausgeprägten Symptomen wie hohem Fieber, intensiven Gliederschmerzen und starker Erschöpfung aus. Auch die Dauer der Symptome ist meist länger als bei einem grippalen Infekt.
Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Schwere und medizinischen Bedeutung: während eine Erkältung meist leicht verläuft und innerhalb weniger Tage abklingt, kann eine Grippe den Organismus stark belasten und unter Umständen ernsthafte Komplikationen verursachen. Gegen die Influenza steht eine gezielte Schutzimpfung zur Verfügung – bei Erkältungen ist das aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Erreger nicht möglich.
Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen?
Eine Grippeschutzimpfung wird insbesondere Menschen empfohlen, bei denen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf erhöht ist. Dazu zählen Personen ab 60 Jahren, Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Asthma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Personen mit einer geschwächten Immunabwehr sowie Schwangere. Bei Schwangeren richtet sich der Zeitpunkt der Impfung nach dem Gesundheitszustand und der Schwangerschaftswoche.
Auch Kinder ab sechs Monaten mit bestimmten Vorerkrankungen, beispielsweise der Lunge, des Herzens, der Leber, der Nieren oder mit neurologischen Störungen, sollten jährlich geimpft werden, da sie besonders anfällig für Komplikationen sind. Darüber hinaus profitieren Menschen, die häufig mit vielen Personen in Kontakt sind, vom Impfschutz, beispielsweise medizinisches Personal, pädagogische Fachkräfte oder Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr.
Eine Impfung kann auch im persönlichen Umfeld helfen, besonders gefährdete Angehörige – wie ältere oder kranke Familienmitglieder – indirekt zu schützen, indem die Weiterverbreitung des Virus reduziert wird.
So kann man eine Grippe behandeln: hilfreiche Tipps
- Bleiben Sie mindestens zwei volle Tage im Bett, auch wenn Sie sich bereits besser fühlen. Der Körper benötigt nicht nur Ruhe, um die Abwehrreaktion zu unterstützen, sondern auch Zeit, um sich zu regenerieren. Frühes Aufstehen erhöht das Rückfallrisiko.
- Richten Sie sich eine sogenannte Genesungsecke ein. Legen Sie sich mehrere Decken, warme Socken, eine Wärmflasche sowie alles Wichtige wie Tee, Medikamente und Taschentücher in Griffnähe zurecht, um unnötige Wege zu vermeiden.
- Trinken Sie gezielt Kräutertees, je nach Symptom: Kamillentee bei Entzündungen im Hals, Thymian bei Husten oder Linden- bzw. Holunderblütentee bei Fieber. Bereiten Sie den Tee frisch zu, lassen Sie ihn zehn Minuten ziehen und trinken Sie ihn schluckweise.
- Inhalieren Sie zwei- bis dreimal täglich mit heissem Wasserdampf und etwas Kamille oder Salz. Halten Sie dazu Ihren Kopf über eine Schüssel, bedecken Sie ihn mit einem Handtuch und atmen Sie durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wiederholen Sie den Vorgang für jeweils 10 Minuten.
- Legen Sie bei Halsschmerzen warme Kartoffelwickel an. Kochen Sie zwei Kartoffeln, zerdrücken Sie diese mit Schale in einem Tuch, lassen Sie das Tuch auf eine angenehme Temperatur abkühlen und legen Sie es für 20 bis 30 Minuten auf den Hals.
- Bereiten Sie Zwiebelsirup selbst zu: schneiden Sie eine Zwiebel klein, geben Sie zwei Esslöffel Honig oder Zucker dazu und lassen Sie die Mischung mehrere Stunden stehen. Nehmen Sie davon mehrmals täglich einen Teelöffel ein.
- Gurgeln Sie drei- bis viermal täglich mit lauwarmem Salzwasser (1 TL Salz auf 250 ml Wasser). Das lindert Halsschmerzen, reduziert Schwellungen und hemmt das Wachstum von Keimen im Rachenraum.
- Sorgen Sie für regelmässige Frischluftzufuhr: lüften Sie das Krankenzimmer stündlich für fünf bis zehn Minuten stossweise, um die Virenkonzentration in der Luft zu senken und die Schleimhäute zu entlasten.
- Halten Sie die Raumluft feucht, indem Sie entweder eine Schale mit Wasser auf die Heizung stellen oder ein feuchtes Handtuch über den Heizkörper legen. Eine Luftfeuchtigkeit von 40–60 % beugt dem Austrocknen der Schleimhäute vor.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein abschwellendes Nasenspray. Setzen Sie es nur abends ein, um besser schlafen zu können, aber nicht länger als fünf Tage, um eine Abhängigkeit zu vermeiden.
- Trinken Sie täglich zwei bis drei Liter Flüssigkeit. Neben Wasser eignen sich warme Brühen, Kräutertees oder heisses Wasser mit frisch gepresstem Zitronensaft. So gleichen Sie Ihren Flüssigkeitsverlust aus und halten Ihre Schleimhäute feucht.
- Kühlen Sie bei hohem Fieber Ihre Stirn mit einem feuchten Waschlappen. Tauchen Sie ihn in kühles, aber nicht eiskaltes Wasser, wringen Sie ihn aus und legen Sie ihn für 10 bis 15 Minuten auf die Stirn.
- Halten Sie Ihre Schlafposition erhöht, wenn Ihre Nase verstopft ist. Legen Sie dazu zwei Kissen übereinander oder nutzen Sie ein Keilkissen. So kann das Sekret besser abfliessen und Sie können leichter durchatmen.
- Essen Sie vitaminreiche, leicht verdauliche Speisen. Setzen Sie auf warme Gemüsesuppen, geriebene Äpfel, reife Bananen oder gedünstetes Gemüse. Diese schonen den Magen und liefern wichtige Mikronährstoffe für die Immunabwehr.
- Lassen Sie sich als Teil der Risikogruppen rechtzeitig gegen das Grippevirus impfen – Grippeimpfstoffe senken das Komplikationsrisiko dieser Infektionskrankheit, die im Winter häufig mit Kopfschmerzen und anderen Krankheiten einhergeht. Bei Symptomen sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.
Eine echte Grippe kann den Organismus stark belasten und sollte deshalb nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wer rechtzeitig reagiert und auf seinen Körper hört, kann den Genesungsprozess unterstützen.