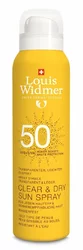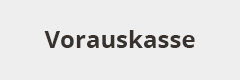Das andere Organ für unsere Verdauung
Das andere Organ für unsere Verdauung
editorial.overview
Was ist die Gallenblase?
Die Gallenblase ist ein äusserst wichtiges Organ des Verdauungssystems. Sie befindet sich direkt unterhalb der Leber in einer Vertiefung, der Gallenblasengrube. Über eine Bindegewebsbrücke ist die Gallenblase fest mit der Leber verbunden. An den Stellen, an denen sie nicht direkt an der Leber anliegt, ist sie von Bauchfell (Peritoneum) überzogen.
An seiner Form erinnert die Gallenblase an eine Birne. Mit einer Länge von etwa 8 bis 12 Zentimetern und einer Breite von 4 bis 5 Zentimetern kann dieses Hohlorgan etwa 30 bis 80 Milliliter der in der Leber gebildeten Gallenflüssigkeit speichern. Das reicht locker für ein ordentliches Essen.
Immer wenn man etwas Fettiges isst, gibt die Gallenblase die gespeicherte Galle über einen kleinen „Schlauch“ (Ductus cysticus) in den Zwölffingerdarm ab. Damit das Ganze nicht einfach so rausläuft, gibt es im Gallenblasenhals eine Art Klappe (Heister-Klappe), die nur dann öffnet, wenn wirklich Bedarf ist.
editorial.facts
- Studien haben erwiesen, dass Kaffee (sowohl koffeinhaltiger als auch entkoffeiniert) den Cholecystokinin-Spiegel im Blut erhöht. Dieses Hormon bringt die Gallenblase zur Kontraktion. Das bedeutet, dass nicht nur Koffein, sondern auch andere Inhaltsstoffe im Kaffee die Gallenblase beeinflussen können.
- Etwa 32 % der Frauen und 16 % der Männer über 40 haben Gallensteine. Die meisten merken davon nichts, da diese oft keine Beschwerden verursachen. Erst wenn Schmerzen oder andere Symptome auftreten, wird eine OP-Behandlung notwendig.
- Die meisten Gallensteine bestehen aus Cholesterin, das sich in der Gallenflüssigkeit zu festen Konkrementen zusammenlagert. Es gibt aber auch seltenere Formen, wie Bilirubinsteine (Bilirubin ist das Abbauprodukt der Erythrozyten) oder Steine aus Calciumcarbonat, die oft durch bakterielle Infektionen entstehen.
- Ohne Behandlung bleiben Gallensteine meist bestehen. Manche Cholesterinsteine können mit Medikamenten aufgelöst werden, das klappt aber nicht immer. Auch Stosswellen-Therapien zur Zertrümmerung der Steine sind möglich, werden aber heute selten eingesetzt.
- Nur etwa jeder vierte Mensch, der Gallensteine hat, aber keine Symptome zeigt, entwickelt innerhalb von zehn Jahren Beschwerden.
Welche Funktion hat die Gallenblase?
Unsere Leber produziert jeden Tag bis zu einem Liter gelbe Galle – eine Mischung aus Wasser, Gallensäuren, Cholesterin, Phospholipiden, Bilirubin und anderen Stoffen. Diese Galle gelangt aus der Leber in die Gallenblase, wo sie durch Wasserentzug eingedickt wird und dabei von gelb zu grün wechselt. Am Ende bleiben so etwa 50 bis 60 Milliliter konzentrierte Blasengalle übrig. Die Wand der Gallenblase enthält Muskelgewebe, das sich zusammenziehen kann, um die Galle bei Bedarf freizusetzen.
Nach dem Essen, besonders wenn fettreiche Nahrung aufgenommen wird, produziert der Dünndarm das Hormon Cholezystokinin. Dieses Hormon signalisiert der Gallenblase, sich zusammenzuziehen. Gleichzeitig entspannt sich ein Ringmuskel (Sphinkter) am Ausgang des Gallengangs in den Zwölffingerdarm. Dadurch wird die eingedickte Galle durch den Gallengang in den Zwölffingerdarm gepresst. Dort macht die Galle dann ihre eigentliche Arbeit: Sie zerlegt die Fettklümpchen in winzige Tröpfchen, damit die Verdauungsenzyme die Fette besser verarbeiten können.
Wie unterstützen Sie heute einen gesunden Gallenfluss?
Was sind die Symptome einer Funktionsstörung der Gallenblase?
Typisch sind Bauchschmerzen rechts, oft unter den Rippen. Sie können auch in den Rücken ausstrahlen oder kolikartig, also krampfhaft, auftreten – vor allem nach dem Essen. Nach dem Verzehr von fettreichen Lebensmitteln kann es zu Übelkeit, Blähungen und Verdauungsstörungen kommen. Viele Betroffene klagen über wiederkehrende Übelkeit oder müssen sich sogar übergeben. Wer länger keinen Appetit hat, kann dadurch auch ungewollt Gewicht verlieren.
Bei einer sogenannten Gallendyskinesie, also einer Bewegungsstörung der Gallenblase ohne Gallensteine, treten oft ähnliche Symptome auf – vor allem Oberbauchschmerzen nach dem Essen und Verdauungsprobleme.
Falls sich die Haut und das Augenweiss gelb färben, ist das ein Warnsignal, dass die Galle nicht richtig abfliessen kann. Wenn es am ganzen Körper juckt, kann auch das mit der Galle zusammenhängen. Fieber oder Schüttelfrost können auf eine mögliche Gallenblasenentzündung hindeuten. Ein Hinweis darauf, dass die Galle nicht richtig in den Darm gelangt, ist hellbrauner Urin und fettiger oder lehmfarbener Stuhl. Allgemeine Abgeschlagenheit und Erschöpfung können ebenfalls auftreten.
Welche Probleme kann die Gallenblase verursachen?
Die Gallenblase kann verschiedene Probleme verursachen, vor allem wenn sich Gallensteine bilden. Diese entstehen, wenn sich Cholesterin, Gallenfarbstoffe und Kalke in der Gallenblase oder den Gallengängen ablagern. Oft bleiben solche Gallensteine zunächst unbemerkt und verursachen keine Beschwerden. Manchmal jedoch blockieren sie den Abfluss der Galle in den Darm und lösen heftige, krampfartige Schmerzen im Oberbauch aus, die von Übelkeit und Erbrechen begleitet sein können. Das nennt man eine Gallenkolik.
Wenn die Galle nicht richtig abfliessen kann, lagert sich Bilirubin im Körper ab, was zu einer Gelbfärbung der Haut und der Augen führt – Gelbsucht. Gallensteine können eine Entzündung der Gallenblase (Cholezystitis) oder der Gallengänge (Cholangitis) verursachen. Die Cholezystitis entsteht meist durch den Druck der gestauten Galle auf die Gallenblasenwand.
Bei den meisten Menschen laufen der Gallengang und der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse zusammen und in diesem Fall kann ein Gallenstein auch eine Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) auslösen. Wenn die Gallenblase durch den Druck der blockierten Galle zu sehr belastet wird, kann sie sogar platzen. Das ist lebensgefährlich und führt zu einer Bauchfellentzündung.
Wiederholte Entzündungen können die Gallenblase dauerhaft schädigen und ihre Schrumpfung verursachen. Langfristige Reizung durch Gallensteine erhöht das Risiko für bösartige Tumore in der Gallenblase oder den Gallengängen. Zudem kann ein Rückstau der Galle auch die Leber und Bauchspeicheldrüse in Mitleidenschaft ziehen.
Die Gallenblase versucht zwar oft, die Steine durch Muskelkontraktionen zu verschieben, damit die Galle wieder abfliessen kann. Wenn das nicht klappt und die Beschwerden öfter kommen, raten Ärzte meistens dazu, die Gallenblase operativ entfernen zu lassen, um schlimmere Probleme nicht zu riskieren.
Welche Folgen kann ein Verschluss der Gallenblase haben?
Viele merken zunächst gar nicht, dass sie Gallensteine haben, da diese lange Zeit keine Beschwerden verursachen. Erst wenn die Steine in Bewegung geraten und den Gallenabfluss blockieren, können typische Symptome auftreten – vor allem sogenannte “Gallenschmerzen”, die auch in die rechte Schulter, den Rücken oder sogar die Brust ziehen können. Wenn der Gallengang durch einen Stein verstopft wird, kommt es zu krampfartigen Schmerzen, die in Wellen kommen und aufhören, wenn dieser sich wieder bewegt.
Diese Schmerzen dauern meist mindestens 30 Minuten an, werden stärker und klingen nach einigen Stunden wieder ab. Die Koliken treten in unregelmässigen Abständen auf, aber nicht unbedingt täglich. Dazu können noch andere Symptome kommen wie Übelkeit und Erbrechen, Schwitzen, Blähungen, Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Lebensmitteln, besonders fettigen und scharfen Speisen, gelegentlich auch Fieber und letztendlich Gewichtsverlust.
Wenn der Verschluss auch die Leberfunktion beeinträchtigt, kann es zu Gelbsucht kommen: Die Haut kann gelb werden und der Urin dunkler. Wenn die Galle nicht abfliessen kann, staut sich Flüssigkeit in oder vor der Gallenblase. Ohne Behandlung kann das zu Entzündungen führen – in der Gallenblase selbst, den Gallengängen oder sogar zu Bauchspeicheldrüsenentzündung. Zudem steigt das Risiko für chronische Leberprobleme oder sogar Eiteransammlungen.
Um schlimmere Komplikationen zu vermeiden, werden Verschlüsse der Gallenblase mit Medikamenten behandelt. Bei Bedarf kommt es zu operativem Eingriff.
Gallenblase entfernen: Wann ist eine OP notwendig?
Manchmal helfen Schmerzmittel, krampflösende Mittel oder Antibiotika eine Zeit lang. Auch kleine Gallensteine können mit Medikamenten aufgelöst werden, aber oft kommen sie wieder. Dann ist eine Operation zur Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) notwendig, da Beschwerden durch Gallensteine oder andere Probleme nicht mehr anders dauerhaft gelindert werden können.
Wenn Gallensteine Schmerzen verursachen, die immer wiederkehren oder sehr heftig sind (z. B. Gallenkoliken), ist diese Operation oft der beste Weg, um die Probleme zu lösen.
Bei einer akuten Gallenblasenentzündung muss in den meisten Fällen schnell operiert werden, um Komplikationen zu vermeiden – da z. B. bei einer Schrumpfgallenblase das Risiko für Gallenblasenkrebs steigt oder die Gallenblase bei schweren Entzündungen zu platzen droht.
Bei der Entscheidung spielen auch persönliche Faktoren eine Rolle, wie das Risiko für Komplikationen bei einer Operation (z. B. Alter, Vorerkrankungen) und die Lebensqualität. Die Standardmethode ist heute die Schlüsselloch-OP (laparoskopische Cholezystektomie). Über einen kleinen Schnitt am Bauchnabel wird eine Kamera eingeführt, dazu kommen noch ein paar Mini-Schnitte für die Instrumente. Die Gallenblase wird komplett entfernt und es gibt kaum sichtbare Narben. Man kann schon kurz danach wieder nach Hause oder bleibt nur ein paar Tage im Krankenhaus.
Bei starken Entzündungen oder Verwachsungen nach früheren Operationen ist ein grösserer Bauchschnitt nötig. Die Erholungszeit nach einer solchen offenen Cholezystektomie ist dann länger.
Was erwartet den Patienten nach der Entfernung der Gallenblase?
Nach der Entfernung der Gallenblase erfolgt in der Regel eine relativ schnelle und unkomplizierte Erholung, insbesondere wenn die Operation laparoskopisch durchgeführt wurde. Bereits am Tag der Operation nimmt man leichte Kost zu sich und ab dem nächsten Tag ist schon eine normale Ernährung möglich. Eine spezielle Diät ist nicht zwingend erforderlich. Es ist aber sinnvoll, anfangs auf fettige und schwer verdauliche Speisen zu verzichten.
Die vollständige Wundheilung dauert etwa 10 bis 14 Tage. In dieser Zeit sind leichte Aktivitäten wie Spaziergänge gut, aber schweres Heben und intensiver Sport sollten vermieden werden.
Nach der OP fliesst die Galle direkt von der Leber in den Darm, ohne zwischengespeichert zu werden und die Fettverdauung kann etwas weniger effizient sein. Daher kann es nach den fettreichen Mahlzeiten zu Verdauungsproblemen wie Völlegefühl, Blähungen oder gelegentlichem Durchfall kommen. In diesem Fall minimiert eine fettreduzierte Ernährung die Beschwerden. Es ist dabei wichtig, auf seinen Körper zu hören und seine Essgewohnheiten entsprechend anzupassen. Die veränderte Fettverdauung und Stoffwechsel können bei einigen Patienten eine Gewichtszunahme verursachen.
Ein Leben ohne Gallenblase ist gut möglich und die meisten Menschen führen ein normales, gesundes Leben. Gelegentliche leichte Bauchbeschwerden oder Durchfälle können vorkommen, sind aber in der Regel vorübergehend.
So bleibt Ihre Gallenblase gesund: Jetzt vorbeugen statt später leiden
- Konsumieren Sie mehr Obst und Gemüse: Diese wirken der Steinbildung entgegen und fördern gesunde Verdauungsprozesse.
- Setzen Sie auf ballaststoffreiche Kost: Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse helfen, die Verdauung zu regulieren und das Sättigungsgefühl zu verlängern.
- Nehmen Sie ausreichend Proteine zu sich: Mageres Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte und fettarme Milchprodukte unterstützen den Muskelaufbau und stabilisieren den Blutzucker.
- Achten Sie auf gesunde Fette: Statt Transfetten aus verarbeiteten Lebensmitteln essen Sie lieber Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Nüssen und Samen.
- Meiden Sie schwer verdauliche Lebensmittel. Besonders fettreiche, gebratene oder stark gewürzte Speisen können die Gallenblase belasten.
- Übergewicht ist ein Risikofaktor für Gallensteine, daher ist eine gesunde Körperzusammensetzung wichtig. Vermeiden Sie aber radikale Diäten und zu schnellen Gewichtsverlust, da dies die Steinbildung fördern kann.
- Essen Sie regelmässig kleine Mahlzeiten. Grosse Portionen können die Gallenblase überfordern.
- Legen Sie Fasten und Ruhepausen ein, um die Gallenblase zu entlasten und zu beruhigen.
- Achten Sie darauf, ausreichend zu trinken. Dies hält die Gallenflüssigkeit dünn und verhindert Stauungen.
- Tägliche Bewegung tut auch der Gallenblase gut. Sport und körperliche Aktivität helfen, das Gewicht zu kontrollieren, und wirken verdauungsfördernd.
- Versuchen Sie, Stress zu reduzieren, da er sich negativ auf die Verdauung und Gallenblasenfunktion auswirken kann.
- Nutzen Sie prophylaktische Heilpflanzen. Schöllkraut und Erdrauch können die Gallenflüssigkeit regulieren, Artischockenblätter fördern die Gallensaftproduktion, Meerrettichwurzel entspannt die Gallenmuskulatur. Bei Gallensteinen sollte aber auf Kurkuma verzichtet werden, da es die Gallenblase reizen kann.
- Bei familiärer Vorbelastung oder Symptomen holen Sie frühzeitig ärztlichen Rat ein. Bei Einnahme von cholesterinsenkenden Medikamenten oder Hormonersatztherapien halten Sie Rücksprache mit dem Arzt, da sie Gallensteine begünstigen können.
- Nehmen Sie Bauchschmerzen, Übelkeit oder Verdauungsprobleme ernst und suchen Sie schon bei ersten Symptomen ärztliche Abklärung. Schmerzmittel und krampflösende Medikamente sollen nur nach Rücksprache genommen werden.
- Bei akuten Problemen suchen Sie schnell medizinische Hilfe, vor allem bei Entzündungen oder Blockaden, um Komplikationen zu vermeiden.
Obwohl die Gallenblase auf den ersten Blick unwichtig erscheinen mag, ist sie für die Verdauung von grosser Bedeutung. Sie sorgt für eine optimale Fettverarbeitung und stellt sicher, dass der Körper mit wichtigen Nährstoffen versorgt wird. Schon kleine Störungen können daher zu grossen Beschwerden führen. Eine bewusste Lebensweise und rechtzeitige Vorsorge helfen jedoch, dieses Organ gesund zu erhalten und langfristig fit und vital zu bleiben.